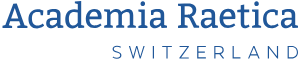31.07.2024
Wie internationale Wörter ins Bündnerromanische finden
Angelica Blumenthal ist wissenschaftliche Assistentin am Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun (I-DRG) in Chur. Für ihre Dissertation erforscht sie mit detektivischem Spürsinn den Weg internationaler Wörter von der Quellsprache ins Bündnerromanische. «Internationalismen sind Wörter, die in mindestens drei Sprachen und zwei unterschiedlichen Sprachfamilien vorkommen. Sie breiten sich oft entlang historischer Handelsrouten und durch kulturellen Austausch von einer Sprache zur anderen aus», erklärt sie. Bisher wurde ihre Integration ins Bündnerromanische kaum wissenschaftlich untersucht.
Durch Literaturrecherchen und Zugang zu über zwei Millionen Zetteln in der Kartothek des I-DRG hat Blumenthal geeignete Begriffe identifiziert. Für ihre Analyse wählte sie zwei unterschiedliche Kategorien: Kolonialwaren wie Banane, Kaffee, Schokolade und Zucker sowie technische und wissenschaftliche Begriffe wie Benzin, Partikel und Vitamin. Ihre interdisziplinäre Herangehensweise vereint Linguistik, Geschichte und Kulturwissenschaften. «Um die genaue Herkunft eines Wortes festzustellen, muss ich alle möglichen historischen und kulturellen Einflüsse berücksichtigen», sagt Blumenthal.
Blumenthal illustriert ihre Forschung am Beispiel von «Kaffee»: «Ende des 17. Jahrhundert verbreitete sich dieser beliebte Muntermacher in der Schweiz und erreichte Graubünden im 18. Jahrhundert. In den entlegeneren Tälern wurde Kaffee erst Mitte des 19. Jahrhunderts zum Alltagsgetränk. Gion Casper Collenberg lieferte 1766 den ersten bekannten Beleg für das Wort ‹Kaffee› im Bündnerromanischen in seinem Reisebericht von La Réunion an seine Verwandtschaft in Graubünden. Möglicherweise existieren jedoch ältere, bisher unentdeckte Belege. Seit 1823 findet sich das Wort regelmässig in bündnerromanischen Wörterbüchern, oft mit unterschiedlichen Schreibweisen wie ‹café›, ‹caffee› und ‹caffè›. Das Dicziunari Rumantsch Grischun beschreibt ‹caffè› als internationales Lehnwort aus dem Türkischen, ohne den spezifischen Lehnweg anzugeben.»
Einen Hinweis auf mögliche Lehnwege liefert der Begriff «Kaffeebohne», so Blumenthal: «In den romanischen Sprachen wird die Kaffeebohne meist als ‹Korn› bezeichnet (zum Beispiel it. grano/chicco di caffè). Im Arabischen heisst die Kaffeefrucht ‹bunn› (dt. ‹Beere›), was im Deutschen und Englischen als ‹Bohne› beziehungsweise ‹bean› interpretiert wurde. Im Bündnerromanischen gibt es sowohl ‹Bohne› (br. fav, fev) als auch ‹Korn› (br. gran, graun) als Bezeichnungen, die räumlich variieren. Für die Surselva und Mittelbünden scheint mir eine Entlehnung aus dem Deutschen am plausibelsten, da hier der ‹deutsche Typus› bei der Bezeichnung der Kaffeebohne vorherrscht. Im Engadin hingegen deutet die überwiegende Nutzung des ‹italienischen Typus› auf eine Entlehnung aus dem Italienischen hin. Eine Entlehnung aus dem Französischen habe ich ebenfalls untersucht, halte sie jedoch für weniger wahrscheinlich.»
Blumenthals Arbeit zeigt, wie eng Kultur und Sprache miteinander verwoben sind. Bis 2026 will sie ihre Doktorarbeit abschliessen und hofft, mit ihren Erkenntnissen einen wertvollen Beitrag zur Sprachwissenschaft zu leisten.
Academia Raetica, Davos
Obere Strasse 22
7270 Davos Platz