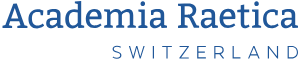23.10.2024
Forschung zur Selbstheilung der Gelenke
«Forschung macht Spass», sagt Laura Mecchi, Doktorandin am AO Forschungsinstitut in Davos, begeistert. «Einer der schönsten Momente ist derjenige, wenn eine Studie erfolgreich abgeschlossen werden kann und man die entsprechenden Antworten auf die zuvor gestellten Fragen bekommt.» Dennoch funktioniert Forschung meistens in ganz kleinen Schritten und dauert Jahre und Jahrzehnte, bis der Erfolg auch am Patienten sichtbar wird. Lauras Credo: «Man muss positiv bleiben, sich nicht von einem Misserfolg überwältigen lassen.»
Mecchi arbeitet im dritten Jahr an einem Projekt, bei dem sie herausfinden möchte, wie sich geschädigtes Knorpelgewebe selbst regenerieren kann. Der Körper kann das Knorpelgewebe an Knie, Hüfte und Ellbogen nicht so schnell heilen wie andere Gewebe, beispielsweise die Haut oder Knochen. Knorpel besitzt nämlich keine Blutgefässe. Deshalb ist es schwierig, dass Zellen dorthin gelangen, um eine Regeneration einzuleiten. Man hat jedoch bereits herausgefunden, dass durch Bewegung und Krafteinwirkung ein spezialisiertes Protein in den Zellen aktiviert wird und dieses die Wiederherstellung von Knorpelgewebe anregt. Die Fragen, denen sich Mecchi zurzeit widmet, lauten: Welche Art von Bewegung erzeugt das beste Resultat? Oder ist es ein Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte, die beispielsweise gerade auf das Knie einwirken? Und wie oft und wie lange pro Tag sollten diese Bewegungen ausgeführt werden?
Die Studien werden anhand einfacher Modelle durchgeführt. Das AO Forschungsinstitut verfügt über mehrere Maschinen mit verschiedenen Stationen, welche die Kniebewegungen nachahmen und somit die Auswirkung auf die Zellen und ihre Veränderung sichtbar machen. Diese Stationen bestehen aus einer Halterung, einem Gerüst und einem sogenannten Bioreaktor. Letzterer besteht aus einer glatten Keramikkugel, wie sie beispielsweise als künstliches Gelenk in der Hüfte verwendet wird, einem Halter und einem Motor. Die Kugel bewegt sich entweder auf und ab (Kompression) oder hin und her (Scherung). Spezielle Stammzellen des Knochenmarks werden in eine 3D-gedruckte Struktur aus Polymer injiziert. Diese liegt in der Halterung, umgeben von einem sogenannten Medium, einer Flüssigkeit mit Nährstoffen, wie sie ähnlich im menschlichen Körper vorkommt, und ist momentan während einer Stunde pro Tag den Kräften der Keramikkugel ausgesetzt. Nach etwa drei bis vier Wochen wird die 3D-gedruckte Struktur unter anderem auf das Vorkommen des besagten Proteins hin untersucht.
«Ein nächster Schritt könnte sein, das Verhalten der Zellen mit einer Entzündung, wie sie zum Beispiel nach einer Knorpelverletzung vorkommen kann, unter dem Einfluss von Bewegung und Kraft zu untersuchen», erklärt Mecchi. Im Jahr 2026 läuft ihr Vertrag am AO Forschungsinstitut aus, und die Studien im Rahmen ihrer Doktorarbeit werden abgeschlossen sein. Danach wird jemand anderes auf der Grundlage von Mecchis Resultaten weiterforschen. Die Chance, den jetzigen Stand ihrer Forschungsarbeit einem breiten Publikum zu präsentieren, erhält Mecchi bereits am Kongress «Graubünden forscht», welcher im November in Davos stattfindet.
Academia Raetica, Davos
Obere Strasse 22
7270 Davos Platz