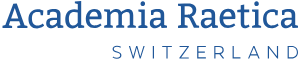28.08.2024
Alpine Pflanzen und ihre unscheinbaren Fressfeinde
Ein Stück unterhalb des Gipfels des Davoser Jakobshorns, auf 2500 m ü. M. mit Blick ins Sertigtal arbeitet Julien Bota, Doktorand am SLF, während der schneefreien Monate. Mit einem Allrad-Truck erreicht er über eine holprige Schotterstrasse seine Untersuchungsfläche – eine Bergwiese, die mit blauen und gelben Pflöcken in 24 fünf mal fünf Meter grosse Parzellen unterteilt ist.
Seit vergangenem Jahr widmet sich Bota zusammen mit weiteren Forschenden hier und auf zwei weiteren Flächen am Jakobshorn – bei der Clavadeler Alp auf 2000 m ü. M. und im Landwassertal auf 1500 m ü. M. – der Frage, wie pflanzenfressende Insekten, Schnecken und Pilzpathogene die dort vorkommenden Pflanzengemeinschaften beeinflussen. «Wir wissen viel über grosse Pflanzenfresser wie Murmeltiere und Rotwild, aber der Einfluss von Insekten, Schnecken und Pilzerkrankungen ist noch wenig erforscht», erklärt Bota. Anders als man intuitiv vermuten würde, ermöglichen diese in vielen Fällen nämlich erst die Koexistenz verschiedenster Arten.
Dieses Projekt ist Teil des internationalen Forschungs-Netzwerks «BugNet», das von Anne Kempel (SLF) und Eric Allan (Universität Bern) ins Leben gerufen wurde. Forschende führen dabei auf allen Kontinenten ausser der Antarktis Experimente in Grasland-Ökosystemen durch, um allgemein gültige Prinzipien über das Zusammenspiel von Pflanzen und Pflanzenfressern herauszufinden und zu verstehen, wie dieses die Ökosysteme beeinflusst.
Am Jakobshorn liegt der Fokus zusätzlich auf den Auswirkungen des Klimawandels auf dieses Zusammenspiel. Es werden verschiedene Szenarien untersucht, um die Veränderungen unter zukünftigen Klimabedingungen zu erforschen. Grundsätzlich ist es zwar so, dass Gebirgspflanzen und ihre Feinde bis zu einem gewissen Grad in höhere Lagen ausweichen können, um den wärmeren Temperaturen zu entgehen. Allerdings kann dies unterschiedlich schnell passieren, so dass Artengemeinschaften aus der Höhe zum Beispiel mit bis dato unbekannten Fressfeinden aus den Tallagen konfrontiert werden, an die sie noch nicht angepasst sind. Auch kann die Erwärmung die bestehenden Artengemeinschaften beeinflussen, in dem sie etwa die Aktivität und Reproduktion der Fressfeinde erhöht oder dominante Pflanzenarten gegenüber langsam wachsenden Spezialisten begünstigt.
Um diese Szenarien zu testen, «verpflanzt» Bota acht Pflanzenarten, die auf mittlerer Höhe vorkommen auf 2500 m ü. M. und 1500 m ü. M. Zu diesem Zweck hat eine Gärtnerei 3000 Setzlinge gezogen, die Bota mit der Hilfe von Studierenden und Zivildienstleistenden an ihrem neuen Standort einsetzt. Einige Pflanzen wachsen in speziellen Erwärmungskammern, die die erwarteten Temperaturveränderungen simulieren, während andere unter den natürlichen Bedingungen untersucht werden. Bota erläutert: «Unser Ziel ist es zu verstehen, wie die Erwärmung die Beziehungen zwischen Pflanzen und ihren Fressfeinden verändert. Womöglich könnten veränderte Wechselwirkungen zwischen den Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze) langfristig sogar grössere Auswirkungen auf die Pflanzenpopulationen und Ökosysteme haben als die direkten Effekte des Klimawandels auf die einzelnen Arten selbst.»
Academia Raetica, Davos
Obere Strasse 22
7270 Davos Platz